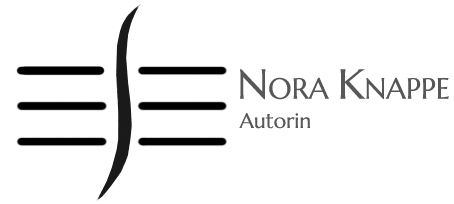… so vor sich hin. Über die Welt. Über die kleinen und großen Dinge des Alltags. Über Begegnungen, Erlebnisse und Verwunderungen.
An dieser Stelle ist davon zu lesen. In beliebiger Unregelmäßigkeit. Mal länger, mal kürzer. Eine Text-Terrine mit ganzen Sätzen. Wohl bekomm’s!
*****
Übrigens …
… gibt es auch ein Vor-der-Tür. Dies stellt man vorzugsweise zu Beginn der Heizsaison fest. Wenn man sich also die Bedingungen im Arbeitszimmer per Dreh am Thermostatknopf ein bisschen angenehmer gestalten möchte und zu selbigem Zwecke sowie auch jenem der Heizeffizienz und Heizkostengeringhaltung die Tür zu schließen beabsichtigt. Schwierig. Unmöglich gar!
Denn da, wo eben noch die Zimmertür war, ja, wirklich: gerade eben noch war sie da!, ist auf einmal eine, nun ja, nennen wir es: interessante Installation. Und gerade weil sie diese künstlerisch-intendierte Aura ausstrahlt, traut man sich gar nicht, zu nahe an sie heranzutreten, geschweige denn sie anzufassen. Nicht, dass man noch was kaputtmacht. Oder plötzlich eine Alarmanlage lospiept. Und das mitten in der Mietshausmittagsruhenzeit! Aber auch wenn selbige längst verstrichen ist, traut man sich noch nicht.
Denn nur mal angenommen, man wagte sich an die erste Reihe dieser abschreckenden Blockade, würde sich alsbald die Frage stellen, die wir schon von dem Hinter-der-Tür-Dilemma kennen: Und nun, wohin mit dir, du DING du? Denn leider, leider, das hat man vorsichtshalber noch mal überprüft, ist bei dem Hinter-der-Tür beim besten Willen kein Platz mehr. Und so schaut man vorerst ratlos, lethargisch und ein wenig verzweifelt auf diese suspekte Nur-vorübergehend-Ansammlung vor der dringlich ersehnten und doch so unerreichbaren Tür. Und man notiert leicht missmutig, aber voll fester Absicht im Kopf: Lampenkarton zusammenfalten und zur Entsorgung bereitlegen (Nur wo?), Druckerkarton verkleben und in den Keller bringen (Aber die Spinnweben!), Kiste mit Verpackungsmaterial und Plastetüten irgendwo anders hin (Nur wohin?), Staubsauger wieder ins Hinter-der-Tür (Wann und wie ist er von dort überhaupt entkommen?), den Sportroller zusammenklappen und irgendwo anders hin (Die alte Leier …) und dann sind’s doch nur noch die restlichen Umzugskartons, die man mal fix wieder abgeben müsste. Das zu erwartende zurückerhaltene Pfand wäre ein starker Anreiz, mit diesem Vorhaben als Erstes zu beginnen – jedoch würde das Hervorziehen der flach aneinander lehnenden Kartons das Umfallen des wiederum daran lehnenden Rollers mit möglicherweise fatalen Folgen für die Glasscheibe in der Tür bewirken. Und das kann doch keiner wollen.
Das mit dem Heizen hebt man sich einfach für später auf. Soo kalt ist es ja nun auch wieder nicht.
(17. Oktober 2024)
*****
Hinter der Tür
Wer eine Wohnung hat, braucht unbedingt ein Hinter-der-Tür. Wenn man nämlich keinen Dachboden hat. Und wenn der Keller voller Spinnweben und also nicht so recht gemütlich ist. (Das Entfernen der Spinnweben wäre freilich eine relativ leicht umzusetzende Maßnahme, um dem Keller zu mehr Gemütlichkeit zu verhelfen, was jedoch ein gewisses Maß an Unerschrockenheit gegenüber Spinnweben voraussetzt.) Außerdem ist der Keller so weit unten. So weit weg. Man müsste nicht nur die Draußenschlappen anziehen, sondern auch den Kellerschlüssel nicht vergessen.
Ein Hinter-der-Tür dagegen ist voll gemütlich und nur perspektivisch-potenziell bei ärgstem Putzversagen voller Spinnweben, und vor allem: Es ist buchstäblich gleich um die Ecke.
Voraussetzung für das ideale Hinter-der-Tür ist natürlich ein gewisser Abstand der Tür zur Wand. Liegt sie in geöffnetem Zustand quasi flach an der Wand an, kann man das Ganze vergessen. Ein gutes Hinter-der-Tür ist eine Nische für sich. Es muss geräumig sein. Und nicht gut einsehbar. Das heißt: Mit einer Glastür funktioniert es ebenso wenig.
Zum Glück habe ich so ein ziemlich perfektes Hinter-der-Tür.
Ach so, nicht für mich persönlich, nein. Aber für all die Dinge, für die es keinen besseren Platz gibt als eben: hinter der Tür.
Der Wäscheständer. Die Leiter. Der Besen. Das noch nicht angebrachte Rollo. Die leeren Kartons, die man demnächst vielleicht noch mal gebrauchen könnte, schließlich ist bald Weihnachten, oder so … Der Staubsauger. Die Kiste mit Kram. Die Rolle mit Antirutschzeugs für Teppiche. Zum Beispiel.
Wieder und wieder steht man beim Einrichten der neuen Wohnung unvermittelt einem Ding gegenüber, schaut es rätselnd an und gibt sich der naiven Hoffnung hin, das Ding wüsste eine Antwort auf die Frage aller Fragen: „Und, wohin jetzt mit dir?“ Angesichts des beharrlichen Ding-Schweigens findet man rasch selbst die Lösung und posaunt beschwingt hinaus: „Ach, erst mal hinter die Tür!“
Neben der zunehmenden Expertise im Hinein-Dahinter-Daneben-Darauf-Stapeln wächst auch die kindliche Freude an diesem versteckenden Verstauen. Allerdings schleicht sich alsbald spielverderberisch die Erkenntnis ein, dass so ein Hinter-der-Tür keine unendliche Weite ist.
Schön sieht das entstandene Erst mal-Konstrukt also irgendwann nicht mehr aus, aber auch dafür gibt es eine praktisch-pragmatische Lösung: Man darf die Tür halt nicht mehr schließen – wenn man sich im selben Raum wie das Hinter-der-Tür befindet.
(8. Oktober 2024)
*****
Notizen aus dem Garten
Neulich, ich war gerade in vielfältiger Weise in den Beeten zugange, erhielt ich eine Sprachnachricht. Ein technisches Empfangsgerät war dafür nicht vonnöten, mein inneres Sensorium genügte. Ich hielt nicht einmal inne in meinem spätsommerlichen Buddeln, Knipsen, Rupfen und Pflücken. Die Botschaft wurde mir auf angenehmste Weise zugewispert, auch wenn es ein wenig durcheinander ging. Auf jeden Fall waren unterschiedliche Stimmen zu vernehmen, ein begeistertes Tohuwabohu. Mal klang es piepsend, mal schmatzend, ein wenig knuspernd auch, und dann war da noch so etwas wie ein seltsames Schlürfen oder Schlabbern – schwer zu beschreiben diese Laute. Folgendes jedoch konnte ich eindeutig herausfiltern:
„Mmmmh, also dass Sie uns wieder diese wunderbare Wildrauke serviert haben, wirklich delikat! Unsere Kolleginnen schwärmten auch sehr von den Radieschen, aber die waren für uns zu weit weg.“
„Rauke ist nicht so unser Ding, aber Ihre Frühkartoffeln sind eine Wucht. Schön, dass Sie noch ein paar in der Erde gelassen haben, unsereiner hat schließlich auch im September noch Appetit.“
„Also, wir fanden ja die Salattomaten köstlich, aber könnten Sie die in der nächsten Saison nicht einfach alle in Bodennähe wachsen lassen, das ist schon etwas mühselig, dieses Recken und Strecken und Hinaufkriechen.“
„Die Zucchini-Blüten haben uns in diesem Jahr besonders gemundet, schade, dass Sie die Früchte jedes Mal so zeitig entfernt haben, wir waren doch schon auf dem Weg dorthin.“
„Apropos auf dem Weg: Eigentlich wollten wir ja endlich mal bei der Kapuzinerkresse einkehren, aber unterwegs sind wir dann bei der Wildrose hängengeblieben. Na, und das war nicht der schlechteste Aufenthalt. Fünf Sterne!“
„Für uns hängen die Früchte ja immer vom Himmel, sozusagen … kicher, kicher. Wie immer mochten wir die Gelbe Bete am liebsten. Vielen lieben Dank!“
„Wir wollten uns noch entschuldigen, dass wir zunächst den Guten Heinrich verschmäht haben, wir wussten ja nicht, was für ein Zeug das da neuerdings ist. Aber wir müssen schon sagen: Gar nicht schlecht, vor allem die jungen Blätter, herrlich zart und saftig. Ruhig mehr davon!“
„Wir können die Zufriedenheit unserer Vorrednerinnen nur unterstreichen. Unser Favorit war ja der Lauch! Also da könnten wir direkt reinkriechen … Ach so, sind wir ja auch, na, Sie werden das sicher verstehen.“
Zufrieden lächelnd ließ ich mir diese Erntedank-Grüße gefallen und antwortete lakonisch-herzlich:
„Gern geschehen!“
Und für nächstes Jahr lasse ich mir wieder was Schönes für unsere Gäste im Garten einfallen. Schon jetzt steht fest: Es ist genug für alle da.
(24. September 2024)
*****
Adigitale Stimmung
Die digitale Welt ist kalt. Nüchtern, fühllos, leer. Entmenschlicht. Und vor allem: entsinnlicht. Sie ist ein funktionales Ding. Ein Werkzeug. Aber sie ist nicht lebendig. Sie ist falsch. Sie bringt nichts Eigenes hervor, sie dient bloß. Das Digitale kann nicht menschlich sein, nicht Mensch sein. Am Ende ist es eben genau das, was uns ausmacht: das Menschliche (seit es diesen künstlich geschaffenen, das Leben aufs Technische reduzierenden Antagonismus gibt: Digital versus Analog). Mir das bewusst zu machen, birgt ein gewisses Maß an Trost.
Als unausweichlich hinnehmen muss ich sie wohl, diese wuchernde Diktatur des Digitalen. Akzeptieren kann ich sie nicht. Gutheißen schon gar nicht. Diese blinde Vergötterung und willenlose Unterwerfung machen mir Angst.
Während ich das denke, im schon mehr nächtlichen als abendlichen Dämmer auf dem Balkon sitzend und einen Schluck Rotwein die Kehle hinabrinnen lassend, nehme ich unvermittelt einen warmen Schein wahr. Ich schaue auf, und – staune: In einer Lücke im Blattwerk des Baumes in meinem Sichtfeld leuchtet der Mond ganz warm. Voll ist er, riesig, glühend orange. Und als ob es nicht genug des Zaubers wäre, schlägt nun die Kirchturmuhr in der Nähe und verrät mir die Abendstunde.
Mir wird warm. In der Seele, wegen dieses Anblicks und dieses Klangs. Im Bauch, wegen des Weins.
Die digitale Welt ist ein bedauernswerter Wicht mit Hang zum Größenwahn, denke ich vergnügt. Nie und nimmer hätte sie solchen Mondschein hervorgebracht. Geschweige denn so einen besänftigend-samtenen Tropfen zum Genuss. Und erst recht nicht ein Wort wie Kirchturmuhr.
(17. September 2024)
*****
Tragisch. Komisch.
Manchmal ist es besser, zweimal hinzugucken. Dann wird aus befremdetem Wundern im Nu erfrischende Erheiterung. Und dann aber ist es wiederum besser, die zur Heiterkeit geführt habende ernüchternde Erkenntnis sogleich wieder aus dem eigenen Bewusstsein zu entlassen. Denn nur so entfaltet sich Gelegenheit, für den Rest der abendlichen Fahrradrunde fantasiereich über diese komische Sache nachzudenken. Die in keinster Weise komisch wäre, hätte man auf Anhieb richtig gelesen. Denn auf der mit Kreide beschrifteten Angebotstafel der Bäckerei stand einfach nur „Tropischer Früchtekuchen“.
Durch eine Beengtheit im Schriftbild, welches von mir ja noch dazu eher augenwinkelig im Vorüberfahren wahrgenommen wurde, es somit also im Grunde gleichzeitig zweifach verunschärfte, ergab sich die Offerte: „Tragischer Früchtekuchen“. Wäre geöffnet gewesen, hätte ich womöglich ein Stück gekauft. Ach was, gleich das ganze Blech! Obwohl ich gar keinen Früchtekuchen esse. Ich hatte einfach Mitleid. Hab mich mal wieder zu vehement zu sehr ins Gegenüber hineingedacht, hineingefühlt. In diesen armen, auf seine Weise tragischen Früchtekuchen.
Ja, und ist es nicht tatsächlich so, dass auf so manch verkorkster Familienfeier, in manch des Konditorischen nicht gänzlich kundigem Café, bei so manchem backhandwerklichen Selbstversuch oder am Ende eines doch irgendwie zu sonnenreichen Wiesenpicknicks ein eben solcher aufgetragen wird (oder besser nicht mehr): ein tragischer Früchtekuchen? Als Harmoniekitt versagt, vom Bäcker verhunzt, in der Wärme deformiert, von den Gästen verschmäht …
Ob nun jenen in der Bäckerei verkauften Kuchen bereits ein solches Schicksal ereilt hatte und es sich mithin um einen in der Realität echt Tragik-erprobten Früchtekuchen handelt (allerdings auch: einen gebrauchten Kuchen), oder aber ihm diese seine in der Zukunft liegende entsprechende Aufgabe kuchengenetisch mitgegeben wird – nun, das gilt es herauszufinden.
(23. Juli 2024)
*****
Menschen & Vögel
Menschen skandieren in den Straßen.
Und die Vögel fliegen am Sommerhimmel.
Menschen brüllen in Mikrofone.
Und die Vögel singen ihr Abendlied.
Menschen schlagen auf Menschen ein.
Und die Vögel schweigen zur Nacht.
(6. Juni 2024)
*****
Tomaten-Trilogie
(nach Haiku-Art)
Aus winzigem Korn
Müht zartes Grün sich empor
Ach, so lang noch hin!
Der Duft grünen Blatts
Über das ganz sacht meine
Finger nun streifen.
Früchte schon bald sich
Rot runden dort, wo jetzt noch
Gelbe Sternlein spitz.
(13. Mai 2024)
*****
Notizen aus dem Garten
Das wohl häufigste von Garten-Menschen verwendete Wort ist nach aktuellen, ganz persönlichen und völlig unrepräsentativen Erhebungen das Wort „endlich“. Ob still bei sich gedacht oder tatsächlich ausgesprochen – immer schwingt da entweder Erleichterung oder Euphorie mit. Für akustisch sensible und empathiegeschulte Rezipientinnen eines solchen „endlich“ ist dabei sogar ein Ausrufezeichen hörbar.
Endlich! geht sie wieder los, die Gartensaison.
Endlich! kann man säen und pflanzen und jäten und mulchen.
Endlich! gibt es wieder belebendes Grün … zu betrachten, zu pflegen, zu ernten, zu beobachten.
Endlich! kann man frische Kräuter pflücken und bergeweise aufs Butterbrot türmen.
Endlich! sind die Radieschen reif.
Endlich! kann man sich wieder vorstellen, dass der Garten doch nicht nur aus kahlen braunen Stöcken, Stengeln und Staudenresten besteht.
Endlich! fangen die ersten Sträucher und Blumen an zu blühen.
Endlich! kann man sich erneut überraschen lassen von all den Pflanzen, die plötzlich wieder aus der Versenkung auftauchen.
Und so geht das immer weiter. Bis es dann eines Tages heißt:
Endlich! ist alles geschafft.
Endlich! können wir mal Pause machen und genießen.
Nur wissen wir ja ganz genau: So eine Pausenzeit währt nicht lang. Denn bald schon – endlich! – sind die Tomaten reif und können-sollen-wollen verarbeitet werden. Und da sind sie nicht die einzigen …
Doch bis dahin werden wir hoffentlich noch oft dankbar dem erlösenden Rauschen lauschen und uns freuen:
Endlich! regnet es mal wieder.
(8. Mai 2024)
*****
Kleine Momente
An schlechteren Tagen klappt es nicht unbedingt. An besseren schon eher. Dass man das Glück, oder sagen wir vorsichtig: die Freude, in den kleinen Momenten des Alltags findet. Und im Grunde ist das doch schon ganz viel, oder nicht?
Ich möchte dem Frühling nahe sein … und gehe mal wieder über den Friedhof spazieren. Diese vielen Frühblüher auf den Wiesen weiter hinten, wundervoll! Und da, auf einmal taumelt etwas Gelbes durch mein Blickfeld – der erste Zitronenfalter des Jahres, meines Jahres wenigstens. Wenn man einen Zitronenfalter erblickt, kann man eigentlich gar nicht anders als zu lächeln. Mir geht das Herz auf … ich glaube, das sagt man so über dieses Gefühl, das von einer winzigen warmen Woge im Bauch begleitet wird.
Jäh dringen Warnrufe von Krähen, Specht und Amsel durch die Luft. Ich schaue hoch, mein Nacken schmerzt zwar und wird sich über diesen gymnastischen Leichtsinn nachher garantiert beklagen, aber egal, ich möchte wissen, was los ist. Und da: Im grellen Mittagshimmel über den riesigen Bäumen kreist ein Rotmilan. Warum er dort kreist, was er erblickt, was er vorhat oder eben nicht – auch das würde ich gern wissen.
Am Gräberfeld der Diakonissen verweile ich kurz, ich sage hier öfter einmal stumm Guten Tag. Ich lese hier und da die Gravuren, erblicke mir bekannte Namen, auch Schwester Elfriede hat jetzt einen Grabstein. Er strahlt noch hell und neu. Alle Steine sind identisch in ihrer Gestalt, kaum wahrnehmbar gibt es feine Unterschiede in der Struktur und Maserung des Materials. Der Anblick dieser Stein-Gemeinschaft, deren sich verlangsamendes Anwachsen in absehbarer Zeit zum Stillstand kommen wird, berührt mich: Alle diese Frauen, die ihr Leben jeweils mit etlichen von ihnen viele Jahrzehnte lang miteinander teilten und gestalteten, sind nun, im Tode, wieder beisammen. Es wirkt auf mich versöhnlich und befriedend.
Vor der Friedhofsgärtnerei stehen jetzt wieder die Regale mit Blumen draußen, herrlich, wie das blüht und leuchtet. Ich gehe daran entlang, schaue, bleibe zuweilen stehen und schaue genauer, vereinzelt laben sich Bienen an den Blüten. Ich werde nichts kaufen – gut, dass ich kein Geld dabei habe, denn sonst würde ich etwas kaufen! –, aber ich genieße den Anblick und den Duft dieser farbenfroh blühenden Galerie.
So viele kleine freudvolle Momente in so kurzer Zeit – ob sie mich durch den Tag tragen werden?
(13. März 2024)
*****
Märzkeks
Man kann ruhig auch Anfang März mal Weihnachtskekse backen. Wann auch sonst, wenn man es in der Advents- und Weihnachts- und Nachweihnachtszeit nicht geschafft hat? Oder nicht hinbekommen. Zu faul gewesen ist. Keine Lust hatte. Immer irgendwas anderes dazwischenkam oder wichtiger war. Na, suchen Sie sich eine Ausrede aus.
Jedenfalls war es nun an der Zeit – aber so was von! Die freundlicherweise schon abgewogenen und in-die-Backschüssel-kipp-fertig in ein Gefäß gefüllten Zutaten waren mit Ei und Butter flugs vermischt oder mehr so vermanscht, denn die ganze Angelegenheit war eine recht klebrige, worüber man sich mal wieder wunderte und schon dachte: Na, ob das so seine Richtigkeit hat? Aber so sind zu backende Teige ja oft: viel zu flüssig, zu zäh, zu klebrig, obwohl man alles ganz genau so gemacht hat, wie es in der Anleitung stand, und am Ende kommt dann doch ein famoses Backwerk dabei heraus. Wenn alles gut geht.
Oft aber wiederum geht nicht alles gut und es kommt etwas Staunenmachendes heraus – jedenfalls etwas, was mit dem Foto im Rezept nicht viel zu tun hat.
Glücklicherweise hatten die besagten ins Glas abgefüllten und zu Weihnachten geschenkten Zutaten kein beigefügtes Bild (so was setzt einen ja doch auch arg unter Erfolgsdruck), sondern eine sehr übersichtliche, laientaugliche Backanleitung.
Und wie man nun den äußerst klebrigen Teig bemüht war, wie geheißen, zu zwölf runden Keksen zu formen, machte die leise Konsistenzskepsis doch schon einer wohldosierten Vorfreude Platz und innerlich kicherte man ein wenig ob dieses post-adventlich-weihnachtlichen Tuns in sich hinein, als ob man gerade einen Streich plante. (Dass in der Tat alsbald Ofen und Teig in diebischer Traulichkeit einen solchen Streich ausführen würden, konnte man zu diesem Zeitpunkt freilich nicht ahnen.)
Damit das Backen auch wirklich gelänge, brauchte man natürlich ein angemessenes Ambiente, also drehte man zu den zwölf Minuten Backzeit noch ordentlich laut das Weihnachtsoratorium auf und fuhr damit fort sich vorzufreuen. „Vorfreude, schönste Freude …“ kam einem in den Sinn und darum hielt man sich erwachsen-tapfer davon ab, zwischendurch in den Ofen zu lugen.
Das tat man erst nach dem Klingeln des Kurzzeitweckers. Und, tja … in der Tat bot sich nun ein famoses Backwerk dar.
Schade, dass ich keine Influencerin bin. Sonst würde ich jetzt irgendwas Digitales anstellen mit meinem flunderflachen Backblech-füllenden Riesenkeks, bei dessen Anblick man überhaupt nicht mehr erahnt, mit welcher Mühe und auch Liebe er einst zu zwölf Einzelkeksen geformt wurde.
Aber ja: Den wahren Meisterwerken sieht man ihren mühsamen Schaffensprozess eben selten an.
(4. März 2024)
*****
Liebevoll kritisch
Die Kunst der liebevollen Kritik beherrscht nicht jeder. Da geht es ihr nicht anders als so manch anderer Kunst. Es ist nun mal nicht jeder kunstbegabt, und dafür habe ich Verständnis.
Umso mehr freue ich mich, wenn sich im eigenen Sozialzirkel doch immer mal wieder Individuen galant hervortun, die sich in dieser seltenen Kunst üben und sich dafür mich als Rezipientin auserkoren haben.
Wobei ich mir noch nicht sicher bin, ob es sich um liebevolle Kritik handelt oder nicht vielmehr um liebevoll-mahnende Erziehungsversuche. Worin ja eine gewisse Vergeblichkeit läge, denn versuchen Sie mal, jemanden in seiner rechnerischen Lebensmitte zu wohlgefallenderem, harmonietauglicherem Verhalten zu bewegen, geschweige denn zu erziehen. Wenn das möglich wäre, wäre die Welt ja eine ganz andere … Andererseits liegt wohl jedem Erziehungsbestreben eine latente Kritik zugrunde, und jede Kritik wiederum zielt doch mehr oder weniger subtil auf die Erziehung bestehender Verhältnisse oder Verhaltensweisen in eine bestimmte Richtung. Oder anders gesagt: Was zu meckern find‘ sich immer. Hach, es ist kompliziert.
Nun, jedenfalls lassen mich gewisse Verwandte und Freunde von Zeit zu Zeit wissen, was ihnen an meinem Verhalten oder vielmehr Wesen missfällt. (Wobei da durchaus ein eklatanter, wenn nicht exorbitanter Unterschied besteht: Am Verhalten kann man etwas ändern, am Wesen schon weniger bis gar nichts. Das ist ja das Wesen des Wesens, oder nicht? Nennen wir es also ausgeprägte Eigenart oder eigenartige Ausprägung?, die hier Ziel der liebevoll-mahnenden Kritik ist.) Und das geht dann so:
„Danke für Deine Postkarte. Ich konnte sogar fast alles lesen.“
Oder: „Danke für Deine Karte, ich denke, ich habe alles entziffert.“
Oder: „Danke für Deine Urlaubskarte. Ich glaube, ihr hattet eine schöne Zeit. Lesen konnte ich Deine Zeilen leider kaum.“
Eine pensionierte Lehrerin – zu deren Schülerinnen ich, nebenbei bemerkt, nie gehörte – brachte es jüngst pädagogisch geübt auf den Punkt und gelangte in ihrer druckschriftlichen Mitteilung zu einer formvollendeten Anrede, über die ich mich noch heute aus tiefstem Herzen freue und amüsiere: „Liebe Sauklaue!“
Das Wort Sauklaue wird in dem vielerseits praktizierten, liebevoll verpackten Handschriften-Mobbing übrigens oft und gern verwendet.
Neulich formulierte jemand so: „Danke auch für Deine letzte Post. Da Du so eine Sauklaue hast, kann ich das dann öfter lesen und wenn ich dann wieder so ein Krakelwort entziffert habe, sind das für mich echte Glücksmomente.“
Na, bitte – Sauklaue macht glücklich! Wer hätte das gedacht.
(1. März 2024)
*****
Notizen aus dem Garten
Wenn es um Bäume und Gehölze geht, bin ich, seit wir den Garten haben, wirklich sehr hellhörig. Trockenheitsresistent – jaaa, her damit! Tiefwurzler – haben, haben, haben! Humusfähiges-Laub-Abwerfer – brauchen wir!
Man darf mir keine Sendungen mehr über Zukunftsbäume ausstrahlen. Und man darf mir auch keine Beiträge mehr über klimaangepasstes Anpflanzen in die Zeitung setzen. Und schon gar keine Informationen zukommen lassen über heimische Sträucher, deren Blüten bei Insekten und deren Früchte bei Vögeln beliebt und begehrt sind. Nein, nein, nein, weg damit!
Wo sollen denn diese vielen Sträucher und Bäume hin? Im Jungstadium mag das alles noch gehen. Aber wir wissen ja, dass beim Pflanzen über das Jungstadium hinausgedacht werden muss. Und das machen wir auch brav. Schweren Herzens und unter wehem Sehnen.
Aber so ein Garten hat nun mal seine Grenzen.
1. Zum Glück! Denn auch das eigene Budget, die eigene Kraft und der eigene Rücken haben ihre Grenzen.
2. Leider! Denn es ist nicht gut auszuhalten, nichts Neues zu pflanzen. Man könnte doch hier noch vielleicht, oder da, oder dazwischen? Was Niedriges ginge doch noch darunter, oder wir geben doch diese Freifläche hier auf und stattdessen …?
Dieses Pflanzenwollen – es ist eine Sucht. Da kann man nichts machen. Außer: Den Gartenkatalog durchblättern und bestellen.
(19. Februar 2024)
*****
Tempo
Es ist tatsächlich möglich: Man kann sich beim Denken zuschauen. Und damit meine ich nicht das verstörend unaufhaltsame Grübeln, das sich manchmal im eigenen Kopf breitmacht, sondern jenes Denken, das mehr so ein innerlich ausformuliertes Dahersagen des Erlebten oder Beobachteten ist.
Zum Beispiel, wenn man leicht übermüdet und der Welt entrückt (und dies nicht aufgrund Drogenkonsums, sondern aufgrund eines Schlafdefizits, was im Endeffekt vielleicht aufs Gleiche hinausläuft) am Steuer seines fahrenden Automobils sitzt und am Straßenrand erstens einen an ungewöhnlicher Stelle im Grünen parkenden Kastenwagen und zweitens ein paar Meter daneben interessante, an ein kleines Kunstwerk oder aber auch an Forschungsarbeiten erinnernde Aufbauten erblickt.
Und noch während man in einer wundersamen Zeitlupenhaftigkeit bemerkt, dass man diese Dinge bemerkt, zieht man seine Schlüsse und denkt: Aha, da steht ein Blitzer. Und während man noch denkt: Na, das geht mich ja nichts an, sieht man sich selbst beim Staunen und Überraschtsein zu, da man für Bruchteile von Sekunden in einen wie in einer Bühnenshow sich öffnenden Regenschirm roten Lichts getaucht wird. Ja, sieht man sich denken, ist ja logisch, dieser rote Blitz, da muss ich wohl zu schnell gefahren sein. Und dieser Gedanke klingt so, als hätte das benannte Ich gar nichts mit einem selbst zu tun.
Wie man nicht umhinkann festzustellen, hat es das eben doch. Sogleich macht man sich, noch immer verwundert ob dieses Erlebnisses, reumütig auf ein Schreiben der Ordnungsbehörde gefasst und ist dennoch – empört und gekränkt. Denn nie und nimmer gehört man zu jenen Verkehrsteilnehmern, die gewohnheitsmäßig regel-ignorant oder aus impulsbasierter Aggression oder aber aus purer Lust am Rasen viel zu schnell fahren.
Niemand möchte diese Erklärung freilich von mir hören oder lesen, aber ich fühle mich doch innerlich getrieben, sie nun hier an dieser Stelle abzugeben: Aus ehrlichem Herzen, guten und reinen Gewissens möchte ich beteuern, dass ich immer, und wirklich immer!, vorschriftsmäßig fahre, manchmal sogar unter dem erlaubten Limit, einfach weil es so praktikabel und entspannt ist, leicht langsamer zu fahren als vorgesehen (ich kann das übrigens nur empfehlen: 90 statt 100 ist ein ausgesprochen angenehmes Tempo).
Und nur in diesem einen schwachen Moment habe ich geträumt, war ich mit meiner Aufmerksamkeit entschwebt, war gewissermaßen nicht von dieser Welt. Wenn ich es recht betrachte, befand ich mich offenbar in einem philosophisch-psychisch-physikalischen Un-Zustand: Denn das Seltsame war doch, dass sich eine innere Verlangsamung vollzog, die mit einer äußeren Beschleunigung einherging.
Und jetzt, da ich diese Zeilen schreibe, denke ich neidvoll an die Astronauten der ISS. Wie ich jüngst mit großer Faszination in einem Bildband über die „Blue Dot“-Mission von 2014 las, legte Alexander Gerst im Schlaf 260.000 Kilometer zurück! Und derweil konnte er träumen, so viel er nur wollte und konnte. Niemals nimmer wäre er dabei geblitzt worden.
Die irdische Welt ist ungerecht.
(8. Februar 2024)
*****
ÖL in der Krise
Das ÖL ist in der Krise. Wir sind mitten in einer ÖL-Krise. Die Anzeichen mehren sich.
Die aktuelle ÖL-Krise hat sich seit langer Zeit angebahnt. Wahrhaben will man sie dennoch nicht.
Dabei betrifft sie uns alle. Wir brauchen ÖL. Ohne ÖL fühlen wir uns nicht sicher. Ohne ÖL geht vielerorts gar nichts.
Alle wollen ÖL, alle brauchen ÖL. Sogar Kirchen, Denkmäler und der See im Park brauchen neuerdings ÖL.
„Mehr ÖL, mehr ÖL“, ruft es allerorten.
Mit ÖL wird verschwenderisch umgegangen – aber seine Qualität lässt nach.
Zunehmend wird ÖL durch private Panscherei verwässert. Privathaushalte protzen mit ihrem eigenen ÖL.
Und noch etwas hat sich verändert.
Jedenfalls kann das jeder mit nur etwas sensiblem Gespür bemerken.
Das ÖL wird kälter. Es wärmt nicht mehr.
Das ÖL blendet uns.
Wir lassen uns blenden vom ÖL. Widerspruchslos.
Früher war ÖL orange. Seit einigen Jahren wird ÖL immer bleicher.
Und seine Quellen werden immer schrecklicher.
Den ästhetischen Anspruch ans ÖL haben wir aufgegeben.
Wir nehmen ihn hin, den hässlichen Schein des modernen ÖLs.
Kommen wir je wieder raus aus dieser Krise des ÖLs – des Öffentlichen Lichts?
(23. Januar 2024)
*****
Wie die Flocken fallen
Was genau ist es, was sich zurzeit da draußen abspielt? Schneefall – das sagt sich so leicht.
Eben noch war es mehr so ein Schneegesinke.
Dann ein Schneegewirbel.
Aus dem Schneegewusel wurde.
Oder doch eher Schneegefussel.
Dann wurde es langsamer, ein anmutiges Schneegeschwebe.
Das sich bald zu Schneegetänzel wandelte.
Kein Vergleich zu gestern! Da war man plötzlich mitten im Schneegestöber.
Das sich zu einem Schneegeprassel auswuchs.
Später beruhigte es sich hin zu Schneegeriesel.
Insgesamt betrachtet: ein ganz schönes Schneegeschnei.
(16. Januar 2024)
*****
Philosophie kompakt
Die Zeit, die man beim Zahnarzt verbringt, ist oft sehr interessant. Man lernt so einiges. Wenn auch nie genug. Gern würde ich zum Beispiel einmal dabei zuschauen, wie meine Zahnärztin mit all den Werkzeugen, die ich nur hören und spüren kann, in meinem Gebiss-Hohlraum so arbeitet. Welches Instrument hat sie in der Hand? Was genau macht sie damit? Und wie sieht das alles aus ihrer Perspektive aus? Also, ich finde so was spannend. Es wäre wirklich interessant, die Prozedur per VR-Brille mitzuverfolgen. Man müsste dann auch nicht mehr so arg die Augen zukneifen.
Aber es soll wohl nicht sein. Und ich kann das verstehen. Ich möchte eigentlich auch nicht, dass man mir beim Schreiben über die Schulter schaut. Und dann herumkommentiert: warum dies, was jetzt, wie das, warum nicht? Besser doch, man lässt mich einfach machen und begnügt sich mit dem Resultat.
Da es also nicht üblich ist, das zahnärztliche Handwerk stirnrunzelnd-staunend mit anzusehen, übt man sich während einer Behandlung in den immer gleichen Tugenden: Geduld, Zurückhaltung, Imagination.
Wenn man es dann doch schafft, seine eigenen Gedanken von dem surrenden, kratzenden und schleifenden Treiben abzukoppeln, hat man gute Gelegenheit, über das eingangs Gefragte – es dient dankenswerterweise stets der freundlichen Einleitung des medizinischen Kommenden – zu sinnieren. Zur Begrüßung ging es diesmal um das Vergehen der Zeit, und wie rasant selbiges wieder einmal vonstatten gehe. Eben war doch noch Weihnachten … Liegt es daran, dass wir älter werden? Ist es symptomatisch für die heutige Zeit, dass sich alles immer mehr zu beschleunigen scheint? Dies sicherlich, aber haben wir nicht auch eine Zunahme der Gleichzeitigkeit oder vielmehr der Gleichzeitigkeiten? Richtig, und dabei alles viel intensiver irgendwie. Tja, also gleichzeitig hoch zwei. Ach was, hoch vier. Und mit einem letzten von Lachen begleiteten Seufzer erreichte einen die Aufforderung: Bitte mal mit der Desinfektionslösung spülen. Die lakonisch-elegante Überleitung zum Eigentlichen.
Philosophie kompakt – in dieser Form gibt es sie wohl nur auf dem Behandlungsstuhl beim Zahnarzt. Und wie im richtigen Leben ist die Zeit dort meist viel zu schnell vorbei. Man hätte doch gern noch ein wenig geplaudert.
(9. Januar 2024)
*****
Leidige Liste
Bevor es zu spät ist, will ich hurtig noch die Sache mit den guten Vorsätzen klären. Die leidige Liste ist lang. Von ganz oben bis ganz unten feixt es mich unerbittlich Kuliblau auf Papierweiß an: Mehr Sport machen. Mehr Sport machen. Mehr Sport machen. (Es ist aber auch echt schwierig … Und wieso eigentlich „mehr“?)
Dazu kommen dann ja noch haufenweise schlechte Vorsätze. Wie zum Beispiel:
Weniger lesen.
Seltener rausgehen.
Ungesünder essen.
Endlich mit dem Rauchen anfangen.
Mehr Nachrichten.
Mehr Handygucken.
Mehr Zeit im Internet.
Weniger Zeit für mich.
Hach, das wird doch wieder nichts.
(4. Januar 2024)
*****
Der Blick zurück
Es ist ja nun einmal so: Zum Ende eines Jahres merkt man es plötzlich – dass wieder ein Jahr vorbei ist. Es bei dieser Feststellung zu belassen, wäre völlig in Ordnung. Aber ein zu Ende gehendes Jahr muss sich Fragen gefallen lassen wie: War es zu schnell, zu langsam, zu voll, zu leer? War es gut oder schlecht oder mehr so lala? War es ein Jahr wie jedes andere, oder war es ein Jahr ohnegleichen?
Ich glaube ja, dass 365 Tage von allem etwas aufweisen. Ein Jahr kann gar nicht nur so oder so gewesen sein. Was wäre das denn für ein seltsam einfallsloses Jahr.
Also, mein Jahr war voll. Und sehr eigen. Ich bin viel herumgekommen, habe viel erlebt, hatte viele interessante Begegnungen und habe mal wieder reichlich neue Erfahrungen gewonnen. Das ging folgendermaßen vor sich:
JANUAR
„Elizabeth und ihr Garten“ Elizabeth von Arnim / „Hörnchen & Bär – Haufenweise echt waldige Abenteuer“ Andreas H. Schmachtl / „Eiger“ Andrea Wisthaler / „Tagebücher 1933-1941“ Victor Klemperer (Lektüre dauert an, ist nur was für die ohnehin dunkle Jahreszeit) / „Mark und Bein“ Walter Kempowski
FEBRUAR
„Ein Leben in Geschichten“ Donna Leon / „Neulich im Himmel“ Elke Heidenreich / „Die Denunziantin“ Brigitte Reimann / „Sein Sohn“ Charles Lewinsky / „Snöfrid aus dem Wiesental. Durch Schnee und Eis zum Wunderpfeifchen“ Andreas H. Schmachtl / „D-Zug dritter Klasse“ Irmgard Keun
MÄRZ
„Zur See“ Dörte Hansen / „Das Essen meines Lebens“ Bettina Rust / „Hörnchen & Bär – Ziemlich quirlige Wald-Neuigkeiten“ Andreas H. Schmachtl / „Berghau“ Angelika Waldis / „Der Ruf des Eisvogels“ Anne Prettin
APRIL
„Mein Garten – mein Paradies“ Susanne Wiborg / „Die Reise nach Sofia“ Angelika Schrobsdorff / „Brumm“ Helmut Barz
MAI
„Eine Frage der Chemie“ Bonnie Garmus / „Bin im Garten“ Susanne Wiborg / „Gestorben wird immer“ Alexandra Fröhlich / „Wo die wilden Frauen wohnen – Islands starke Frauen und ihr Leben mit der Natur“ Anne Siegel / „LiES! Das Buch – Literatur in Einfacher Sprache“ Hauke Hückstädt (Hg.)
JUNI
„Familienfoto“ Wolfgang Eckert / „Blendende Aussichten“ Simone Lappert / „Ganz bei mir“ Gerlinde Kaltenbrunner / „Der kleine Mönch und die Sache mit der Stille“ Zacharias Heyes
JULI
„Regenkatze“ Sarah Kirsch / „Gartenzeit“ Susanne Wiborg / „Brotjobs & Literatur“ Balint, Dathe, Schadt und Wenzel (Hg.)
AUGUST
„Ehrlich & Söhne – Bestattungen aller Art“ Ewald Arenz / „Musenküsse – Die täglichen Rituale berühmter Künstlerinnen“ Mason Currey / „Doppelleben“ Alain Claude Sulzer / „Das Café ohne Namen“ Robert Seethaler
SEPTEMBER
„Das Tal in der Mitte der Welt“ Malachy Tallack / „Mein Rügen“ Claudia Rusch / „100 Jahre Leben – Hundertjährige geben Antworten auf die großen Fragen“ Kerstin Schweighöfer / „Kleine Probleme“ Nele Pollatschek / „Frau Dr. Moormann & ich“ Elke Heidenreich
OKTOBER
„Wir hätten uns alles gesagt“ Judith Hermann / „Heute bei uns zu Haus“ Hans Fallada / „Nur Mut“ Silvia Bovenschen / „Lettipark“ Judith Hermann / „Leonard und Paul“ Rónán Hession
NOVEMBER
„Wie ich Schriftsteller wurde“ Hans Fallada / „Die Halligpastorin“ Gertrude von Holdt / „Und was machen Sie beruflich?“ Rolf Dobelli / „Die Grenzen meiner Sprache – Kleine philosophische Untersuchung zur Depression“ Eva Meijer / „Die Kanzlerin – Eine Fiktion“ Konstantin Richter
DEZEMBER
„Mädchen auf dem Felsen“ Jane Gardam / „Reclams klassischer Adventskalender“ / „Mich hat niemand gefragt – Tage ums Jahr“ Martina Burandt / „Ich bin ganz, ganz tot in vier Wochen – Bettel- und Brandbriefe berühmter Schriftsteller“ Birgit Vanderbeke (Hg.) / „Schallplattensommer“ Alina Bronsky / „Islandhoch“ Sarah Kirsch
(29. Dezember 2023)
*****
Und jetzt: Musik!
So. Geschenke haben Sie vermutlich längst alle beisammen. Sehr vorbildlich. Weihnachtspost verschickt oder just in Arbeit? Wunderbar. Eingekauft fürs Festmenü ist auch? Prima. Gästebetten sind bezogen, alle Freunde- und Verwandtentreffen bis ins Letzte durchgetaktet? Einwandfrei. Dann kann’s ja losgehen mit Weihnachten.
Mooo-ment! Haben Sie denn auch schon einen festlich gestimmten Ohrwurm? Na? Nein, der übliche, gängige, weit verbreitete zählt nicht. Wir wollen nichts wissen von letztem Weihnachten und verschenkten Herzen und so, da kann singen, wer wolle. Wir brauchen was Individuelles!
Jetzt noch? Auf die Schnelle? Wo sollen wir den denn herkriegen? Das wird doch nichts mehr.
Nur die Ruhe, das wird was. Das kriegen Sie hin. Wie wäre es mit:
Magnificat von Bach. Immer wieder wundervoll!
Dixit Dominus von Händel. Ich meine, das rockt.
Oder lieber was ohne Singen? Pure Melodien eignen sich genauso als festlich gestimmter Ohrwurm, muss auch nicht unbedingt was mit Weihnachten zu tun haben:
Canon von Pachelbel, ein Klassiker.
1. Violinkonzert von Bruch, ist ne Wucht!
Concerti von Prinz Johann Ernst von Sachsen-Weimar, gehen garantiert jedem irgendwann auf die Nerven.
(Zu all diesen Werken lässt sich übrigens wunderbar Rückengymnastik oder Hausputz machen.)
Sollte Ihnen etwas davon gefallen, empfehlen Sie es gern Ihren Heranwachsenden. Womöglich wäre Ihr Nachwuchs Begründer eines neuen Trends. Jedenfalls ich zumindest würde mich wahnsinnig freuen, wenn demnächst Klassik aus den Rucksäcken und Handtaschen wummert. Wenn schon ungefragt Beschallung im öffentlichen Raum, dann gern was Schönes!
Von mir aus auch „Für Elise“. Es wäre ein Anfang.
(20. Dezember 2023)
*****
Jahrestag eines Satzes
„Ich bleibe Ihnen ja erhalten.“ Das hatte meine Psychotherapeutin zu mir in unserer letzten Sitzung gesagt. Ein Jahr ist das her – und ich denke immer noch und immer wieder einmal an diesen Satz. Diesen Satz, dessen Echo viele Erinnerungen hervorruft. Erinnerungen an eine sehr eigenartige und wichtige Zeit.
„Ich bleibe Ihnen ja erhalten“, sagte sie also. Und das brachte mich durcheinander. Denn ich war auf Abschied eingestellt. Unsere auf zwei Jahre verteilten Stunden waren aufgebraucht. Und im Grunde war es auch gut damit – es gab vorerst nichts mehr, wobei mir meine Therapeutin hätte helfen können. Ich war doch nun auf einem guten Weg.
Sicherlich: Ich hätte gern immer so weitergemacht – jede Woche zum Termin gehen, in 50 Minuten über mein Tun und Denken und Fühlen sprechen, mich dabei mal irritieren und mal bestärken lassen, alles sein und sagen dürfen, was in mir ist, und diesen warmen, inneren Halt spüren, den die Therapeutin mir vermittelte.
Andererseits hoffte ich insgeheim natürlich schon, diese Hilfe nicht mehr zu benötigen, denn das hieße ja, wieder in einer unsagbar tiefen seelischen Krise zu stecken, in einem lähmenden Nebel umherzuirren … Das wollte ich so schnell nicht noch mal durchleben müssen.
Wieso sagte sie dann diesen Satz: „Ich bleibe Ihnen ja erhalten.“ Ach so, dachte ich verwirrt, dann sehen wir uns also doch noch mal, sehen wir uns wieder? Eine unwahrscheinliche Aussicht. Als ob sie meine Gedanken hören konnte, erklärte sie: „Ich meine: innerlich. Als innere Therapeutin. Die Ihnen auf der Schulter sitzt oder wo auch immer. Und dann immer mal wieder reinquatscht.“
Ja, natürlich, die innere Therapeutin! Die war mir im Laufe der zwei Jahre wichtig geworden. Sie hatte unmerklich und dann eines Tages, als ich es eben doch merkte, umso präsenter in mir Gestalt angenommen. Sie hatte sich aus vielen zunächst unsichtbaren Molekülen zusammengesetzt und schließlich materialisiert. Fortan war sie ein imaginäres Gegenüber und ein freundliches Korrektiv. Ein subtiles Wirken ging da vor sich.
Auch nach dem Ende der Therapie hielt dieses Wirken an. Nur dass es mit den Monaten weniger wurde, allmählich verblasste. Und doch ist die innere Therapeutin – wie prophezeit – jederzeit da, sollte ich sie brauchen. Ich kann jederzeit das Bild unserer Sitzungen in mir wachrufen und befinde mich für einen hilfreichen Moment wieder in der vertrauten Umgebung des Sprechzimmers, mit dem vertrauten Gegenüber. Der große Vorteil: Die innere Therapeutin hat immer einen Termin frei!
Dass mir meine Therapeutin seit dem letzten Termin noch mindestens viermal im Traum erschienen ist – jedes Mal frappierend real und sehr symbolkräftig –, hatte sie mit ihrem Satz sicherlich nicht im Sinn gehabt. Manchmal stelle ich mir vor, sie und ich würden uns eines Tages zufällig über den Weg laufen. Und dann? Würden wir zwanglos plaudern, vielleicht zum ersten Mal ein richtiges Gespräch – denn bis dahin war ja von ihrer Seite aus alles im Prinzip ein einziges Zuhören und Absorbieren gewesen.
Oder würde es, aus lauter Gewohnheit, doch eine Therapiesitzung werden, nur im Freien eben. Sie: „Wie geht es Ihnen?“ Ich: „Ja, also …“ Und dann stehen wir lange beieinander und nach 50 Minuten schaut sie auf ihre Armbanduhr und sagt: „Unsere Zeit ist um. Für heute.“
Wäre es so? Oder wäre es so wie bei Judith Hermann, die in ihrem Buch „Wir hätten uns alles gesagt“ davon erzählt, wie sie ihrem einstigen Psychoanalytiker in Berlin auf nächtlicher Straße begegnet, ihm heimlich folgt und schließlich an einer Kneipentheke neben ihm sitzt.
Ich habe sie beim Lesen um dieses Erlebnis beneidet. Denn ich halte diese Begegnung für wahr. So bizarr sie auch sein mag.
(14. Dezember 2023)
*****
Das Wichtigste vergessen
Da ist man nun seit einem Jahr selbstständig, also berufsbezogen. Man hat an alles gedacht und vieles zum ersten Mal überhaupt angegangen und absolviert. Steuer- und Versicherungsstatus geklärt und halbwegs verstanden. Öffentlichkeitsarbeit betrieben. Kostenvoranschläge erstellt. Honorare verhandelt. Verträge unterschrieben. Rechnungen geschrieben. Zwischen all diesen selbstverwalterischen Leitpfosten sogar inhaltlich gearbeitet. Durststrecken mit der antizipierten baldigen Fata Morgana einer Oase überstanden.
Man hat also an alles gedacht, hat man gedacht. Und dann war plötzlich Advent. Und woran hat man natürlich nicht gedacht? An das Wichtigste – die Betriebsweihnachtsfeier.
Und jetzt: Bitte nicht stören! Bin im Meeting mit mir selbst, um einen Termin zu finden; um abzustimmen, ob ich zusätzlich zu mir noch einen Alleinunterhalter buche; um zu klären, wer von mir Tee, Kaffee, Plätzchen und Mandarinen mitbringt; um noch die wichtigsten Arbeitsdinge zu notieren, die zu besprechen wären (auch wenn ich bei der Weihnachtsfeier eigentlich Dienstliches aussparen möchte); um mir zu überlegen, mit welchem Nonsenspalaver ich mir in der geselligen Runde auf die Nerven gehen könnte; um mich vorzubereiten auf ein paar spontan wirkende, in jedem Falle motivierende, bestärkende und leicht unbeholfen-salbungsvolle Worte als Chefin, in denen ich natürlich nicht vergesse, mir zu danken für alles Geleistete und Geschaffene, bei allen Schwierigkeiten habe ich doch als Team bewiesen, dass ich allein-gemeinsam sehr vieles voranbringen kann und gewappnet bin für alle noch vor mir liegenden Herausforderungen (sic!) … und jetzt wollen wir uns aber nicht länger in großen Ansprachen verlieren, sondern den Abend genießen … Prost, Büffet, et cetera pp.
(12. Dezember 2023)
Wenn der Aktendulli leuchtet
In Erinnerungen zu schwelgen, insbesondere den positiven – wobei dieses positiv geartete Schwelgen gar nicht so schwierig ist, da wir ohnehin dazu neigen, die negativen Dinge zu verdrängen, was leider wirklich nur in Bezug auf vergangene Ereignisse funktioniert, jedoch weniger in Bezug auf gegenwärtige Schlechtigkeiten, denen wir routiniert viel zu viel Gewicht geben … aber ich schweife ab, also, in Erinnerungen zu schwelgen, kurzum: sich der Nostalgie hinzugeben, soll gesund sein. So las ich neulich in einer wissenschaftlichen Zeitschrift. Und die hatte auch gleich ein schönes Verb für diese zwar unbezahlte, aber durchaus weit verbreitete Beschäftigung zur Hand: nostalgieren.
Das gefällt mir, also dieses Wort: nostalgieren. Warum ist man da nicht längst von selbst drauf gekommen? Das klingt doch wirklich ganz zauberhaft und friedlich und angenehm. (Mal ganz abgesehen davon, dass es offenbar doch noch geschieht, dass wir schöne Wörter nicht nur verlieren, sondern auch welche hinzugewinnen.)
Und ich weiß nun wirklich nicht mehr, wie es dazu kam – vielleicht weil ich am Abend der Lektüre besagten Artikels feststellte, dass in meiner Taschenlampe zwei neue Batterien benötigt wurden und ich mein Batterieschubfach konsultierte. Das ist voll mit langweiligen R6-Batterien, die offenbar vielfach benötigt werden. Just in diesem Moment kam mir in den Sinn, dass es früher (mein Früher: so 80er und DDR) auch Flachbatterien gab. Die hatten oben drauf zwei Metallzungen, was ihnen die Anmutung eines Aktendullis mit klobigem Anbau gab. Aktendulli ist nun wohl ein Wort, dem vermutlich stark nostalgierender Büromief anhaftet, das aber bei mir kleine Erinnerungsglücksströme fließen lässt, da es mich in den geliebten und oft besuchten Schreibwarenladen auf meinem Schulweg (damals!) zurückversetzt, in dem wir auch Winkelmesser und Tuschkasten kauften.
Aus diesen Flachbatterien jedenfalls konnte man sich im Nu (oh nein, schon wieder quatscht die Nostalgie rein, aber ich meine grad nicht Muckefuck, wirklich nicht!) eine Taschenlampe selber basteln. Man brauchte nur noch eine kleine Glühbirne, die man einfach immer vorrätig hatte, einen Schnipsgummi, und schon war sie fertig. Das fand ich einfach großartig. Einfach und großartig. Und habe darum andächtig bewundernd gestaunt, als mir mein großer Bruder das beibrachte.
Gibt es heute noch Flachbatterien? Alles, was heutzutage im Batteriemilieu flach ist, ist wahrscheinlich ein Akku und so winzig und schmal, da kann man kaum eine Glühbirne dranbasteln. Die wiederum es ja auch nicht mehr gibt. Nicht mehr so richtig, nicht mehr so wie früher …
Ach, mir wird schon ganz sentimental, ich mache hier Schluss und ziehe mich auf mein Sofa zurück – zum Nostalgieren. Das kann dauern …
(5. Dezember 2023)
*****
Herausforderung
Früher war alles – nein, nicht, was Sie jetzt denken – früher, wollte ich sagen, war alles viel, viel schlimmer. Denn:
Wir hatten Probleme. Es gab Schwierigkeiten und hohe Anforderungen. Es galt Hindernisse und Hürden zu überwinden. Wir kamen in Bedrängnis oder gar Not. Wir machten Krisen durch. Fanden uns in Kompliziertheit und Dilemma wieder. Sahen uns Widrigkeiten ausgesetzt. Mussten mit Risiko und Gefahren umgehen. Hatten am Ende gar die Katastrophe vor Augen.
Das ist zum Glück alles vorbei. Denn heute, sehr verehrtes Publikum, haben wir dies alles nicht mehr, heute … und an dieser Stelle ertönt jetzt vor Ihrem geistigen Ohr ein musikalischer Spannungsbogen-Jingle … heute haben wir die – tadaa:
Herausforderung.
Ist das nicht schön?
Herausforderung. In diesem Wort steckt so viel Elan, so viel dynamischer Sportsgeist. Alles ist machbar, lösbar, zu bewältigen und zu schaffen (aber ich fange schon wieder an mit dem Herumsynonymisieren, Entschuldigung). Jedenfalls ist die Herausforderung ein wahres Multitalent in jeglicher Welt- und Lebenslage, ja, so dermaßen multi, dass es einem die Abwechslung liebende Sprache verschlägt.
Wie genau dieser euphemistische Floh namens Herausforderung in unser aller Ohren und schließlich Münder kam, lässt sich wohl genauso wenig ergründen wie der ominöse Weg so manch anderer vermeintlich alternativlosen und wenig ideenreich dem Englischen entlehnten Universalvokabel wie starten, Box oder Fake.
Aber wir wollen nicht kleinlich sein, lassen alle Wörterbücher einfach im Regal stehen und schalten das eigene Gehirn jetzt auf stumm.
Und falls jemand Texte von unten anfängt zu lesen, hier die Zusammenfassung des Kommenden:
Wir finden das mit der Herausforderung, wie soll ich sagen, in 2023 absolut mega!
(30. November 2023)
*****
Zwischen Lachen und Weinen ist Pudding
Letztens war ich auf dem Friedhof und musste lachen. Nicht sehr laut, mehr so in mich hinein und nur ganz wenig aus mir heraus. Es war so einer von diesen kurzen Auflachern, die mit einem Nasenschnaufen verbunden sind. Ein kleines Für-sich-Lachen. Zurückhaltend oder zurückgehalten, ich weiß es nicht. Ein Lachen jedenfalls, das bei aller Gedämpftheit und Kürze eine ganze Geschichte zu erzählen vermag.
Ich musste also lachen, weil ich an Pudding dachte. An warmen, blubbernden Pudding.
In mir drinnen, da war an diesem Tag so eine Traurigkeit, von der ich nicht wusste, woher sie kam und was sie von mir wollte. Na gut, Letzteres wusste ich eigentlich schon: Sie wollte, dass ich weine. Weil Traurigkeit sich zwar gern wiederholt zu einem Menschen gesellt, aber nicht allzu lange in diesem Menschen verweilen möchte. Sie möchte hinaus, und dafür nimmt sie gern Tränenströme in Anspruch. (Für die Traurigkeit, so scheint mir, ist das ein Vergnügen wie auf dem Rummel: Noch mal! Noch mal!)
Aber da ich mir meine Traurigkeit nicht erklären konnte, wollte ich eben nicht weinen. Vielleicht hatte ich auch Angst, dass es dann so schnell nicht wieder aufhört und ich in einen mir wohlbekannten Traurigkeitssog gerate. Einen Sog, in dem ich für dieses scheinbar grundlose Weinen nach und nach viele schwere Gründe finden würde, bedrückende Erklärungsversuche, die dann darin münden würden, dass mir das menschliche Dasein mal wieder fragwürdig und sinnlos erscheint.
Manchmal ist es ja aber auch so, dass man zwar anfängt zu weinen, aber nach kurzer Zeit merkt: Dieses Weinen ist nicht sonderlich ergiebig. Man wundert sich dann, dass es sich trotzdem gemeldet hat.
Um welche Sorte Weinen es sich handelt, weiß man meistens erst, wenn man sich das Weinen überhaupt gestattet, ihm also gestattet, seinen Lauf zu nehmen.
Dazu fühlte ich mich an diesem Tag nicht imstande. Darum habe ich es zurückgehalten, gedeckelt, unterdrückt. Bis es mir letztlich doch zu viel wurde und ich eine Runde mit dem Fahrrad fuhr, um diesen inneren Stau irgendwie loszuwerden.
Mein Traurigkeitsmagnetismus navigierte mich zum Friedhof. Dort saß ich dann auf einer Bank in der Herbstsonne, es war eine friedliche, besänftigende Stimmung – und da spürte ich es: Wie es in mir drinnen großblasig blubberte. Eine warme, zähe Masse dehnte sich in zufällig hier und da anwachsenden Wölbungen, bis sie als satte Blasen platzten.
Diese zähe, blubbernde Masse, so kam es mir vor, war meine Traurigkeit. Meine Traurigkeit war ein kochender Vanillepudding. Ja, das ließ sich so genau definieren, denn erstaunlicherweise war diese Masse recht hell, sie war vanille-gelb. Und diese Vorstellung des vor sich hin blubbernden Puddings fand ich sehr warm und tröstlich.
Wahrscheinlich war das eine ziemlich schiefe Metapher, die nur in diesem Augenblick seelischer Verwirrung aufging, aber immerhin brachte mich diese seltsame sinnliche Wahrnehmung dazu, kurz aufzulachen. Und das wiederum hatte einen Effekt, als ob ich den Topf vom Herd zöge: der Pudding hörte auf zu blubbern. Jedenfalls für den Moment. Denn im Grunde wusste ich, dass es heilsamer wäre, den Topf wieder auf die Herdplatte zu schieben, um der Traurigkeit die ihr zustehende Gelegenheit zu geben, ins ungehemmte Brodeln zu geraten und als kleine Pudding-Eruption zu enden. Mit angebranntem Bodensatz und allem Drum und Dran. Aber ich hatte noch immer keine Ursache für mein Weinbedürfnis gefunden. Und sowieso nicht genügend Taschentücher dabei.
Wie ich dann über diese wallende Traurigkeit nachsann und allmählich einsah, wie unsinnig es ist, sich in dieses Ringen mit ihr zu begeben, denn am Ende würde sie doch zu ihrem Recht kommen, da wusste ich plötzlich, wie die Pudding-Metapher zu mir gekommen war.
Ich erinnerte mich daran, wie ich damals nach meiner letzten Psychotherapiestunde mit all meiner Abschiedstraurigkeit nach Hause eilte und das starke Bedürfnis verspürte, mir einen Pudding zu kochen. Ich hatte nur Schokopuddingpulver da. Aber das war egal. Ich hatte auch überhaupt keinen Appetit auf Pudding. Auch das war egal. Ich wollte ihn in diesem Moment nur eben ganz dringlich kochen.
Meinen Traurigkeitspudding.
(24. November 2023)
*****
Ultrasauberes Nilferd
Neulich war ich in einer Schule. Das hatte berufliche Gründe. Ein paar Kindern erzählte ich was vom Pferd. Wobei das nicht ganz stimmt: Nur einem Kind erzählte ich was vom Pferd. Nämlich, dass man es mit P schreibt. Das war nur so eine unaufhaltsame Randbemerkung meinerseits, weil ich auf dem Blatt Papier, das vom Kind zu betexten war, das Wort „Nilferd“ erspähte. Ich war nicht in erster Linie mit diesen Kindern zusammen, um mit ihnen Rechtschreibung zu üben. Es war einfach ein Reflex, dieses von dem Kind in kreativem Prozess notierte Wort zu berichtigen.
Erst hinterher kam mir in den Sinn, dass das „Nilferd“ womöglich Absicht gewesen sein könnte. Denn vielleicht beherrschte das Kind, es muss so um die elf Jahre alt sein, die isländische Sprache und hatte nun ein besonderes Wort geschöpft. Denn ferd – wenngleich das d hier ein Runenbuchstabe sein müsste, den die deutsche Tastatur nicht hergibt – heißt auf Isländisch Fahrt, Reise. Und das Kind hatte offenbar nicht das Tier Nilpferd im Sinn gehabt, sondern ein Abenteuer – eine Nilreise eben! Mit Isländern an Bord oder mit einer isländischen Reederei oder sogar von Island aus zum Nil, ach, die Globalisierung treibt wundersame Blüten, und warum sollte nicht auch eine aufgeweckte Viertklässlerin davon Wind bekommen haben? Und ich Dussel hatte das in meiner pseudo-lehrerhaften Attitüde einfach übersehen und freundlich-mahnend ein korrigierendes P empfohlen.
Und man könnte meinen, ich möchte jetzt damit angeben, dass ich selber auch so ein bisschen Wind bekommen habe, vom Isländischen jedenfalls. Ja, das kann schon sein. Es turnt mir halt immer noch im Kopf herum und will manchmal raus. Die Sätze, die ich einst für meine Island-Ferd auswendig gelernt und sogar zur Anwendung gebracht hatte, die sind eben immer noch da. „Briefmarken nach Europa“ erfragen – kein Problem. Auf die Frage „Wie geht es?“ zu antworten: „So lala“ – kein Problem.
Und noch immer könnte ich genauso souverän in Erfahrung bringen, wo denn die Toilette sei.
Selbige Frage lag mir nach fast 45 Minuten kreativen Beisammenseins mit den Kindern denn auch dringlich auf der Zunge, ohne dass dies einen kausalen Zusammenhang hatte – der Frühstückskaffee war halt durch. (Am Rande bemerkt: Kaffee auf Isländisch ist ganz einfach: Kaffi. Das i spricht man in diesem Falle wie ein e.)
Und so beendete ich die Stunde noch vor dem nichtvorhandenen Pausenklingeln mit einem beherzten „Ach, dann machen wir jetzt einfach etwas früher Schluss“, um frei heraus hinzuzufügen: „Ich muss nämlich mal dringend aufs Klo.“ Kurzes Gekicher in der Schülerinnenschaft. Die Frage nach dem Wo war durch ein munteres Kind schnell geklärt, sicherheitshalber gab es mir noch einen Warnhinweis mit auf den Weg zu den Toiletten: „Ähm, die sind aber nicht ultrasauber.“
Diesen Zustand war ich – in meiner gewissen Eile – gewillt hinzunehmen und fand glücklicherweise eine leere Kabine auf der Mädchentoilette. Noch schmunzelnd über diese komische Episode eben erwartete mich allerdings eine vom wegweisenden Kind nicht erwähnte Kalamität: In der gesamten Kabine war es zwar durchaus sauber, wenn auch nicht ultra-, aber kein Fitzelchen Klopapier zu entdecken.
Erst vermutete ich versäumtes Nachschub-Bereitstellen, hatte dann Schülerinnen-Schabernack im Verdacht, sah andererseits aber auch nirgends einen Rollenhalter, bevor sich in mir die Erkenntnis breitmachte, dass hier womöglich bereits im Toilettenfoyer eine ungefähr benötigte Anzahl von Blättern mitzunehmen wäre.
Zum Glück habe ich aus reichlicher Unterwegstoilettenerfahrung immer einen Notvorrat im Rucksack, und den Rucksack in diesem Falle mit dabei.
Für eine ähnlich papierlose Nil-Ferd wäre ich auf jeden Fall präpariert.
(21. November 2023)
*****
Psyche im All
Die Psyche ist ein wundersames Ding. Obwohl, ein Ding? Das wäre ja gelacht. Denn mit Dingen wissen wir umzugehen. Die Psyche aber ist kein Ding, leider. Darum ist sie kompliziert. So viel weiß man schon: Sie macht, was sie will. Sie entzieht sich uns. Sie ist kaum erklärbar. Ja, sie ist schwer zu fassen.
Man weiß auch nicht so recht, ob man das überhaupt möchte: die Psyche zu fassen bekommen. Wie würde man sie aufnehmen? Sehr sacht und fürsorglich mit der zur Schale geformten Hand – so als ob man ein winziges Vogelküken in Obhut nähme? Oder doch eher grob, ganz zupackend und bestimmt – damit sie einem auch ja nicht wieder entwischt?
Und wie ginge es dann weiter?
In ersterer Version würde man vermutlich anfangen, mit der Psyche zu sprechen; man würde sie fragend anschauen, sie dann vielleicht tatsächlich etwas fragen, sie schweigen lassen oder erzählen, das ginge anfangs wohl stockend und zögerlich, aber dann gewönne sie bald an Vertrauen und Sicherheit. Und man würde sich hier und da wundern, aber dies vorerst für sich behalten. Man würde sie freundlich anlächeln und sich alsdann bemühen, sie zu verstehen und mit ihr zu interagieren. Ein langwieriger Prozess.
Kürzer, wenn nicht gar sehr kurz, wäre der Prozess in zweiterer Version. Sie ergreifen, umschließen und nicht mehr fortlassen, sie – gezielt oder doch aus Unachtsamkeit – quetschen und letztlich zerdrücken. Dann kurz die Hände aneinander abwischen und mit den wichtigen Dingen des Lebens weitermachen.
Aber nun, da man einen Zeitungsbericht über eine wissenschaftliche Entdeckung las, ist beides hinfällig. Und mal wieder geriet das eigene Weltbild ins Wanken. (Das ist übrigens eine Lieblingsbeschäftigung von Weltbildern: wanken. Aber das nur am Rande.)
Die Psyche also, ich gebe das hier ganz nüchtern wieder, ist: ein kartoffelförmiger, metallhaltiger Riesenklumpen. Ein Schutthaufen im All. An der schmalsten Stelle ist der/die/das Psyche mehr als 230 Kilometer breit.
Und irgendwie hat diese riesige Weltraumkartoffel auch noch mit dem Ursprung der Erde zu tun. Aber diese Erläuterung nahm man vor lauter Erschütterung nur noch sehr unscharf wahr.
(17. November 2023)
*****
Notizen aus dem Garten
Nun sind die Beete leer. Es gibt nichts mehr zu tun. Der Garten ruht. In diese ernüchternde Realität muss man sich fügen. Ich denke zurück an diese phasenweise Freude, einfach in den Gemüsegarten gehen zu können und etwas zu ernten. Was eben gerade reif ist, alles zu seiner Zeit.
Aber immer noch ist er schön, unser Garten. Auch im Winter wird er schön sein. Anders schön. Er verändert sich. Und es ist ja auch erfreulich, dass man nun – da keine Zucchini und keine Ringelblumen mehr über ihn hinwegwuchern – den selbst angelegten kleinen Ziegelsteinweg wieder sieht. Oder dass die Gräserstauden jetzt erst recht zum Hingucker werden – so ganz ohne blühende Konkurrenz ringsum.
Und etwas Grünes wächst ja doch noch: Winterlauch und Spinat. Hoffen wir, dass die Wühlmäuse daran vorbeibuddeln! Ein paar treue Gewächse wollen mich trösten: Hier und da blühen abermals Phazelie und Ringelblumen. Sogar Kapuzinerkresse und Wicke haben den ersten Frost überstanden. Die wilde Malve hält sich tapfer. Und willkürlich verstreut erinnern charmant-vertrocknete Wildblumenreste an einen bunt blühenden Sommer.
Leere Beete stecken voller schöner Erinnerungen. Leere Beete sind aber auch ein schmerzlicher Anblick. Sie stimmen mich melancholisch – das, was jetzt kommt, verlangt wieder Geduld. Aushalten und Abwarten.
Aber dann, welch Glücksfall, gab es ja doch noch etwas zu tun: reichlich Laub auf die leeren Beete verteilen! Jetzt haben es alle Käfer und Spinnen auch schön kuschelig, so stelle ich mir das jedenfalls vor. Und die Regenwürmer haben einen guten Winterfuttervorrat.
Am frostig-kalten nächsten Morgen ein kurzer Gang in den Garten, bevor es an die Drinnen-Arbeit geht. Und: Was für ein Anblick! Raureif-Kristalle glitzern auf den im Sonnenlicht golden leuchtenden Laubblättern. Jedes Jahr wieder diese unfassbare Freude an der Schönheit des Raureifs – als ob man ihn zum ersten Mal im Leben erblickte.
Ach, wenn das doch auch die Käfer und Spinnen und Regenwürmer sehen könnten …
(13. November 2023)
*****
Mitleid mit Mützen
Bei den Zeitungsmenschen früherer Tage hieß es: Die Geschichten liegen auf der Straße. Das sollte bedeuten, dass man nur mal vor die Tür gehen muss, die Augen aufmachen, die Ohren auf Empfang stellen, kurz: sein eigenes Beobachtungs- und Wahrnehmungsinstrumentarium auf Betriebstemperatur bringen und schließlich mit einer Story zurück ins Büro kommen. Oder zweien, das war dann noch besser.
Ob dieser Spruch heutzutage auch noch Gültigkeit besitzt, vermag ich nicht einzuschätzen. Sicherlich liegt auch heute noch die ein oder andere Geschichte auf der Straße. Aber ich vermute, sie liegt dort weitaus länger herum, als ihre Ahnen hatten liegen müssen. Es wird über sie hinweggelatscht, sie wird übersehen, es regnet, es wird matschig, die Geschichte sieht immer morbider aus, man möchte sie – so man sie denn sähe – eigentlich auch gar nicht mehr anschauen. Ist ja alles von gestern.
Nicht anders ergeht es krummen Gurken, Äpfeln mit Schorf oder zu kleinen Paprikaschoten im Supermarkt. Die will keiner. Gewollt sind riesige, genormte, makellose Früchte. Behaupten jedenfalls Industrie und Handel: Der Kunde will das so. Mich als Kundin hat noch nie jemand gefragt. Wann und wo werden solche Befragungen durchgeführt?
Aber es stimmt wohl, der moderne Mensch ist eben anspruchsvoll. Man könnte auch sagen: verwöhnt, verzärtelt, ein lachhafter, verbequemlichter Digitalschrumpfkopf. Aber das ist eine andere Geschichte.
Ich wiederum gehöre nun zu der Sorte Mensch, die Mitleid hat mit all diesen vermeintlich unschönen Dingen. Ich habe Mitleid mit dem krummen, zu kleinen und leicht schadhaften Gemüse und – kaufe es (wenn so was überhaupt noch in der Warenauslage zu finden ist!). So wie ich Mitleid mit interessantem Sperrmüll habe – und aus seiner Obdachlosigkeit errette. Und ja, ich habe Mitleid mit den Geschichten, die auf der Straße liegen.
Im aktuell zu besprechenden Fall handelt es sich um Mützen.
Innerhalb von zwei Tagen begegnete ich vier verlorenen Mützen. Und das ist keineswegs metaphorisch gemeint etwa als Umschreibung für verpeilte Mitmenschen, ach je, da habe ich aufgehört zu zählen … Nein, ich meine Mützen.
Sie lagen auf der Straße, auf der Brücke, auf der Kreuzung, auf dem Promenadenweg … wie die sprichwörtlichen Geschichten. Und was habe ich gemacht – es muss alte Gewohnheit aus meiner Zeit bei der Zeitung gewesen sein: Ich habe sie aufgehoben. Zwei jedenfalls. Eine habe ich mitgenommen und gewaschen. Die zweite habe ich aufs Brückengeländer gelegt. Bei der dritten kam ich mir schon komisch vor. Und die vierte sah wirklich übel aus.
Und letztlich: Was will ich auch mit so vielen Mützen? Mein Mitleid hat dann offenbar doch seine Grenzen.